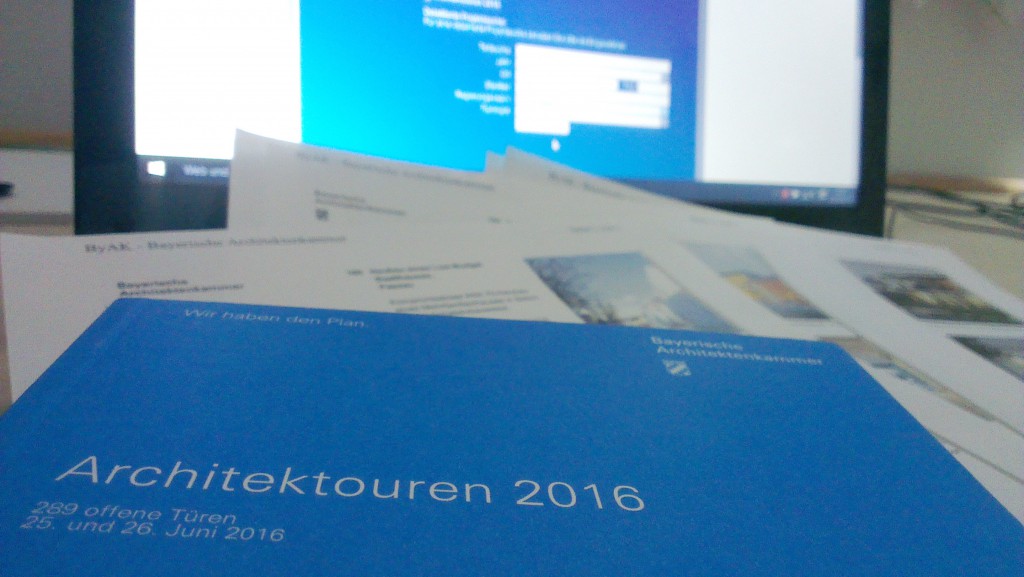Bodenplatte statt Keller: Das war eine Grundsatzentscheidung, die aber auch deshalb klug war, weil man nicht ganz so tief ins Erdreich des hinten steil abfallenden Grundstücks musste. Foto: Karin Polz
Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen vom Traumhaus. Wenn er sein Haus plant, setzt er diese Vorstellungen anfangs begeistert um. Dann kommen Verwandte, Bekannte, Freunde und sagen „Das kannst du doch nicht machen!“ Woraufhin die Pläne geändert werden und die individuellen Planungen der Massen-Meinung weichen. Im schlimmsten Fall. Im besten Fall lässt man sich nicht dreinreden und macht (nach umfassender Beratung), wie man es sich wünscht. Darüber, was andere bei meinem Haus anders geplant hätten, kann ich gleich eine ganze Serie machen. Teil 1 handelt davon, dass mein Haus keinen Keller hat.
Warum kein Keller?
Gegenfrage: Warum ein Keller? Das Argument, dass man im Keller viel zusätzlichen Platz hat, fand ich nie besonders überzeugend. Denn auf viel Platz sammelt sich nur viel Krempel.
Was viele erst einmal für einen Kamin halten, ist die Zentralheizung. Ein solcher Pelletofen steht bei den meisten im Keller, es gibt aber auch Modelle für den Wohnbereich, wie dieses von Windhager. Foto: Hendrik Schwartz
Also was wäre in meinem Keller sinnvoll untergekommen? 1. Die Heizung. Der Brenner der Zentralheizung steht im Wohnzimmer (darüber schreibe ich vielleicht noch mal mehr), der Pufferspeicher und die Technik stehen im Haustechnikraum hinter der Garage. Und das Holzpellet-Lager ist in der Dachschräge über der Garage. Wobei die Garage Teil des Hauses ist – sie ist also nicht als Kellerersatz zusätzlich geplant worden. 2. Waschmaschine und Trockner. Stehen bei mir sichtgeschützt im Gästebad auf zwei Quadratmetern. Für zwei Quadratmeter muss man nicht ein ganzes Kellergeschoss bauen. 3. Weihnachtsdeko, Werkzeug, Hobby-Equipment. Ist im ganzen Haus verteilt. Unser Garderobenschrank ist deckenhoch, ganz oben bringt man eh nur Sachen unter, die man selten braucht (Weihnachtsdeko). Im Gästezimmer steht ein Schrank, in dessen linken Teil wunderbar ein Snowboard passt. Und in der Garage gibt es viele Meter Regal.
Warum ich nichts im Dachboden verstaue? Weil ich einen solchen auch nicht besitze. Ich wohne in einem Haus fast ohne Stauraum – und es klappt wunderbar. Muss nicht bei jedem so sein, klar. Eine ehrliche Bestandsaufnahme, für was man wie viel Stauraum braucht, kann eine Entscheidungshilfe sein.
Ist es billiger, ohne Keller zu bauen?
Über der Garage ist viel Platz – der schräge Hohlraum wird als Pelletlager benutzt. Foto: Karin Polz
Auf jeden Fall. Natürlich braucht man statt einem Kellergeschoss dann eine Bodenplatte, die ebenfalls viel Geld kostet. Aber man braucht eben viele andere Dinge nicht: Fliesen und Bodenbelag für ein ganzes Stockwerk, Wandfarbe für ein ganzes Stockwerk, Elektroleitungen, Steckdosen, Leuchten für ein ganzes Stockwerk. Außen- und Innentüren, Fenster, die Kellertreppe, die Energie, um den Keller später zu heizen – das alles spart man sich.
Zwischen 20.000 und 25.000 Euro habe ich für die Bodenplatte meines Hauses bezahlt. Ein Keller hätte ungefähr das Doppelte gekostet. 18.200 Euro Mehrkosten veranschlagt Achim Linhardt in seinem Buch „Attraktiv bauen mit kleinem Budget“ (DVA, ISBN 978-3-421-03816-6) bei einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern und zwei Wohngeschossen für eine Vollunterkellerung. Verglichen mit dem Gesamtpreis eines Neubaus könnte man natürlich sagen: Für 10 Prozent zusätzliche Kosten bekommt man zusätzliche 100 Quadratmeter. Aber wenn man die Fläche nicht braucht, wieso sollte man dann dafür Geld ausgeben?
Und aus architektonischer Sicht?
Mit Keller hätte sicherlich so einiges anders ausgeschaut. Erstens muss ja so ein Keller ein bisschen aus der Erde schauen, damit man auch Licht hineinbekommt. Mein Haus wäre dann sicherlich nicht so flach auf der Erde gestanden – genau das macht aber einen großen Teil der architektonischen Wirkung aus. Und drinnen ist die Treppe in den ersten Stock sehr markant. Wenn wir da zugleich noch eine Kellertreppe hätten unterbringen müssen, wäre das sicherlich auch anders geworden.
Was ist die Alternative zum Keller?
Es gibt in Wohnhäusern massenhaft ungenutzen Raum – unpraktische Winkel im Raum; Zimmer, die einen Tick zu groß für die vorgesehene Nutzung sind; halbhohe Räume unter Treppen oder unter Dachschrägen. Wir hätten zum Beispiel im Schlafzimmer ein Eck hinter dem Kamin gehabt, das niemand genutzt hätte. Jetzt ist der nicht einmal zweieinhalb Quadratmeter große Raum mit einer Schiebetür abgetrennt und von unten bis oben mit Regalen versehen – was man da alles unterbringt! Sinnvoll ist es, schon bei der Planung solche Flächen im Blick zu behalten und gegebenfalls Trennwände oder Einbaumöbel dafür vorzusehen.
Entscheidungshilfen
Stauraum für Weihnachtsdeko, Bügelbrett und Sportzeugs ist im von Schreinerin Ronja Weranek maßgefertigten Garderobenschrank. Foto: Karin Polz
Ich wollte von Anfang an keinen Keller, weil ich damit nur muffige, feuchte, dunkle Räume assoziiert habe. Insofern war die Entscheidung leicht. Ansonsten gilt: Alles notieren, was in den Keller soll, und sinnvolle Alternativen suchen. Mit einem ebenerdigen Hauswirtschaftsraum ist das Problem vielleicht gelöst. Wer andere Meinungen hören will, kann zum Beispiel den Artikel „Am Keller sparen kann teuer werden“ von Marcus Stölb aus der FAZ nachlesen oder „Keller – ja oder nein“ auf bauen.de. Als Inspiration für alle ohne Keller gibt es hier „6 geniale Ideen, um die Waschmaschine im Bad zu verstecken“ und „Kreative Stauraum-Ideen für mehr Platz“.
Ohne Keller zu bauen war aber nicht die einzige Entscheidung, die für Stirnrunzeln bei anderen gesorgt hat. Schon vorher war bei einigen Skepsis angesagt, nämlich beim Baugrundstück. Kein Südhang, sondern ein Nordhang stand zur Wahl. Darum geht es dann im nächster Teil der Serie: „Das kannst du doch nicht machen! – Teil 2: Bauen am Nordhang“.
Aber sagt mir jetzt erst mal, was ihr von Kellern haltet: Braucht man einen? Oder kann man darauf verzichten? Welche kreativen Lösungen gibt es denn für die Unterbringung von Waschmaschine, Heizkessel und Wasserkästen?
Hier geht es zu den weiteren Teilen der Serie „Das kannst du doch nicht machen!“: